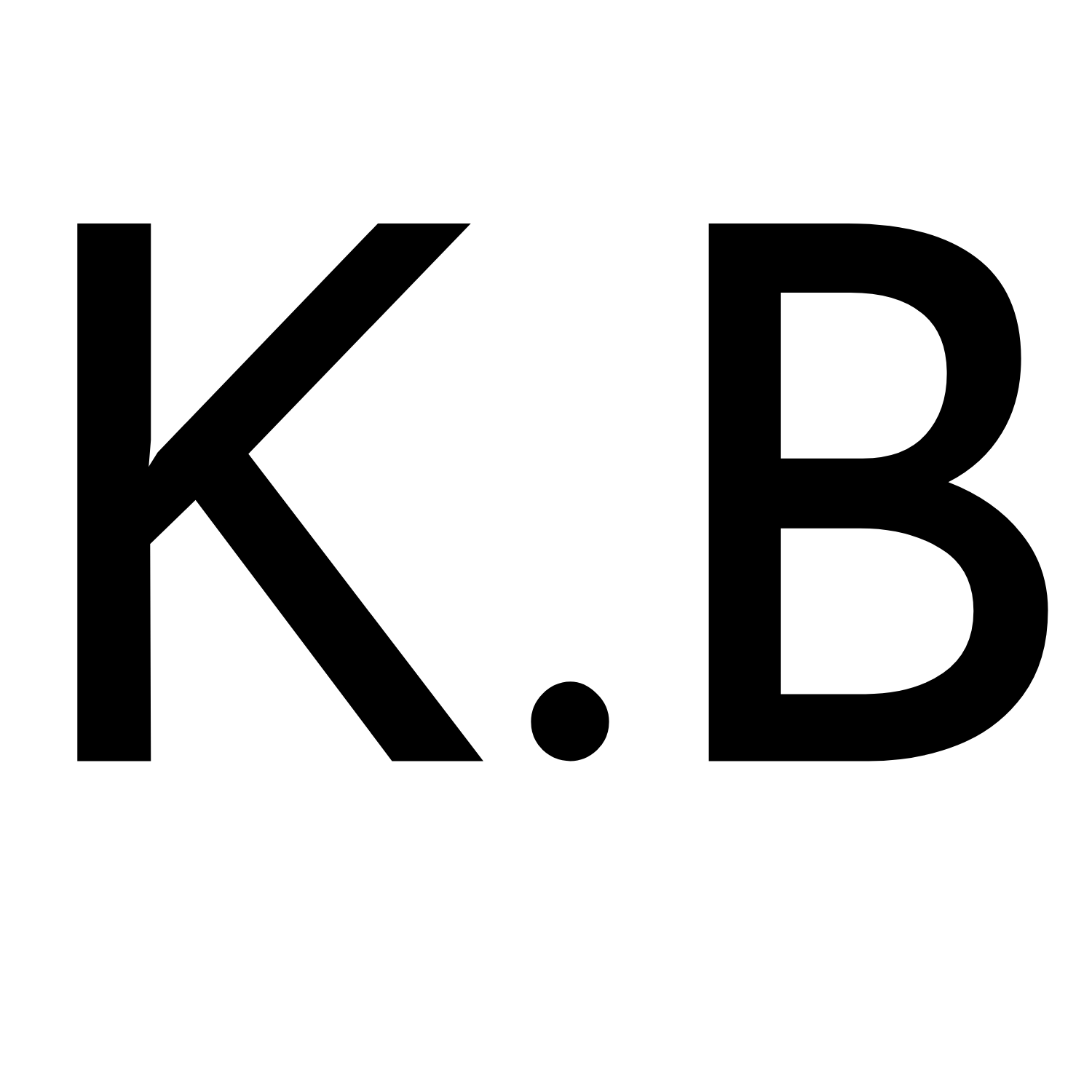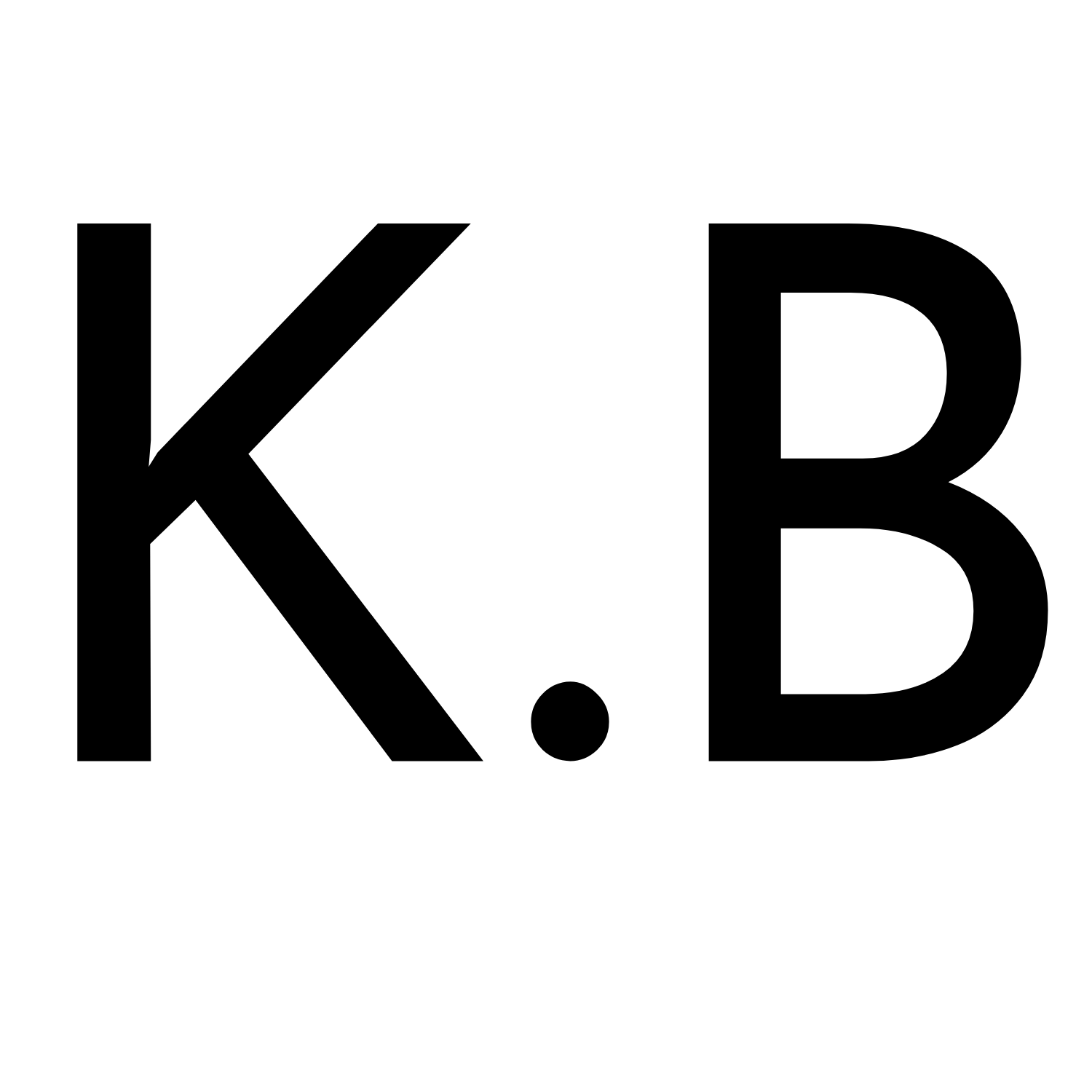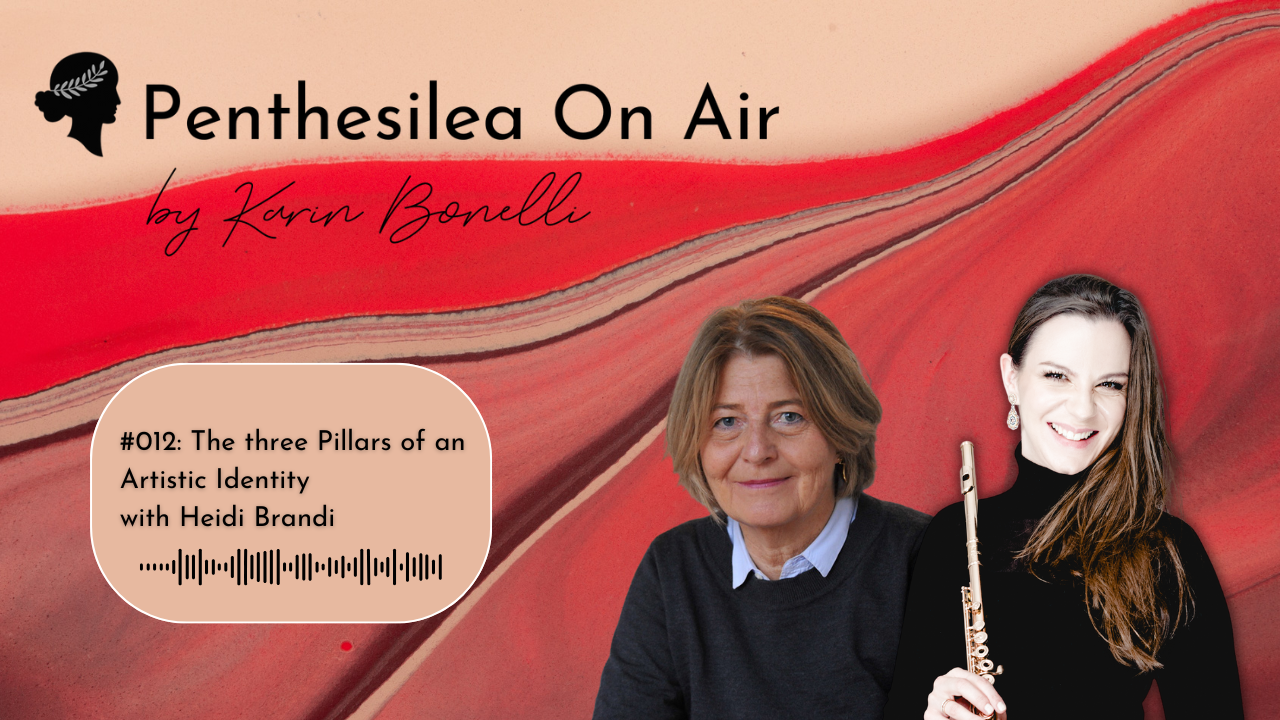Variablen einer künstlerischen Identität - ein Gespräch mit Diplom-Psychologin Heidi Brandi
Ich hatte die große Ehre, ein tiefgründiges Gespräch mit Heidi Brandi zu führen, der Gründerin des Zentrum für Berufsmusiker in Hamburg. Durch ihre jahrzehntelanger Erfahrung in der Arbeit mit klassischen und Jazzmusikern zählt sie heute zu den führenden Expertinnen auf dem Gebiet der Musiker*innengesundheit. Ihr Buch „Die Identität des Berufsmusikers zwischen Ich, Instrument und Orchester“ befasst sich mit den psychologischen Herausforderungen einer Musikerkarriere.
Heidis Mission: Musikergesundheit ganzheitlich denken
Musikerinnen und Musiker mit präventiven, diagnostischen und therapeutischen Werkzeugen zu unterstützen – für einen starken Geist und einen gesunden Körper.
Auf meine Frage, was sie zur Gründung des Zentrums motiviert habe, antwortete sie:
„Die kurze Antwort: Es gab so etwas noch nicht. Die lange: Es ist das Ergebnis meiner Biografie.“
Während ihrer langjährigen Forschungstätigkeit stellte sie fest, dass physiologische und psychologische Aspekte in der Musikausbildung und -praxis oft getrennt behandelt werden – meist mit Fokus auf Leiden oder Symptome.
Ihre Arbeit mit kindlicher Entwicklung (12 Jahre), mit Krebspatient*innen (ebenfalls 12 Jahre) und ihre tiefe Auseinandersetzung mit emotionaler Regulation und Stressbewältigung prägten sie entscheidend. Der wichtigste Impuls kam jedoch von Professor Hugo Schmale, der bereits 1984 als Erster in Deutschland über körperliche Faktoren im Orchester schrieb. Auf seine Anregung hin gründete Heidi 2013 – gemeinsam mit Schmale und Professor Christian Kunert – ihr Zentrum.
Ein Zentrum mit besonderem Geist
Heute arbeiten dort rund zehn Fachkräfte, darunter vier bis fünf Psychotherapeut:innen. Diese Behandlungen können über die jeweilige Krankenkasse abgerechnet werden – ein entscheidender Aspekt, da private Therapieangebote für viele schlicht unbezahlbar sind. Das Zentrum kooperiert zudem mit Physiotherapeut:innen und externen Spezialist:innen.
Was das Zentrum einzigartig macht, ist sein ganzheitlicher, präventiver Ansatz – mit besonderem Fokus auf die musikalische und berufliche Identität.Tabuthemen in einer scheinbar offenen Generation
Ein zentrales Thema in unserem Gespräch war die Diskretion. Heidi betonte, wie wichtig ein sicherer Raum ist – denn obwohl junge Musiker:innen oft selbstbewusster auftreten, gibt es nach wie vor viele Tabus: Schmerz, Angst, Scham, Lampenfieber, Zukunftsängste.
Gerade in Orchestern oder Hochschulstrukturen fällt es vielen schwer, sich Hilfe zu holen – aus Angst, von Kolleg.innen oder Professor.innen gesehen und abgewertet zu werden. Hier zeigt sich der große Vorteil der Unabhängigkeit des Zentrums.„Leistungsmusik“ und die Kunst der Regeneration
Wir diskutierten auch Heidis Begriff der „Leistungsmusik“, besonders im Zusammenhang mit Probespielen. Musiker:innen, so sagt sie, erbringen Höchstleistungen wie Spitzensportler. Ein fünfstündiges Wagner-Werk verlangt volle körperliche und mentale Präsenz.
Doch im Gegensatz zum Sport fehlt in der Musik oft eine Kultur der Regeneration. Während im Leistungssport Pausen essenziell sind, wird vor Probespielen meist noch intensiver geübt – häufig mit gegenteiligem Effekt.
„Regeneration ist eine Frage der Verantwortung. Man muss lernen, mit Körper, Seele und Umwelt umzugehen – sonst bleibt die Gesundheit auf der Strecke.“
Vorbereitung auf Probespiele: Mehr als nur Technik
Heidis Sicht auf Probespiele:
„Es gibt keinen Standardplan. Jeder Mensch braucht etwas anderes.“
Statt pauschaler Ratschläge arbeitet sie individuell – je nach Persönlichkeitsstruktur. Häufig glauben Musiker:innen, dass mehr Übung mehr Sicherheit bedeutet. Doch das Gehirn kann durch Überlastung ins Stolpern geraten. Ihre Empfehlung:
„Konzentriere dich vor einer schwierigen Stelle auf zwei schöne Passagen davor und danach – wiederhole diese. Das Gehirn verbindet sie, integriert die schwierige Passage und löst die Angst.“
Variablen einer künstlerischen Identität
Ein zentrales Thema des Gesprächs war die künstlerische Identität. Für Heidi beruht sie auf einem Dreiklang:
Bindung (zum Instrument, zur Musik…)
Autonomie (Selbstfürsorge, Grenzen, Verantwortung…)
Musikalische Kompetenz (emotionale Ausdruckskraft, technische Meisterschaft…)
Aus dieser Triade entsteht die innere künstlerische Persönlichkeit.
„Künstlerische Identität beginnt, wo das bloße Kopieren endet.“
Sie entwickelt sich oft in der Jugend – in der Ablösung von Lehrenden, Eltern und fremden Idealen. Identität wird nicht gemacht, sondern integriert, wie ein inneres Kaleidoskop. Und: Sie kann nicht zerstört werden, höchstens blockiert. Die therapeutische Arbeit besteht darin, diese Identität neu zu organisieren und zugänglich zu machen.
Vom Orchesterleben und der inneren Stärke
Die Integration der eigenen Identität in ein Orchester ist komplex. Orchester sind per se nicht-demokratische Systeme. Man muss lernen, sich einzufügen – ohne sich selbst zu verlieren.
Auch bei Probespielen lassen sich mentale Tools nutzen – etwa das aus dem Sport stammende Storyboard, eine mentale „Landkarte“ der Herausforderung oder die Arbeit mit Ego-States. Die wichtigste Fähigkeit bleibt aber:
„Körper und Gehirn unter Stress beruhigen zu können – sofort. Das muss Teil des Lebens werden, nicht nur der Vorbereitung.“
Praktische Tools für den Alltag
Ein bewährtes Mittel ist das autogene Training zur Stressregulation. Es basiert auf der Erkenntnis, dass Gedanken, die Stress erzeugen, durch andere Gedanken ersetzt werden können – schnell und gezielt.
„Es ist keine Meditation oder Esoterik, sondern eine mentale Fähigkeit zur Leistungssteigerung.“
Darüber hinaus teilte Heidi mit uns eine sehr einfache aber effektive Atemübung, die direkt vor oder sogar während des Auftritts unser Stresslevel senken kann.
Ich selbst bin zutiefst dankbar für diese Begegnung und inspiriert von Heidis Arbeit und freue mich darauf, diese Diskussion weiterzuführen.
🎧 Die komplette Folge kannst du hier anhören: