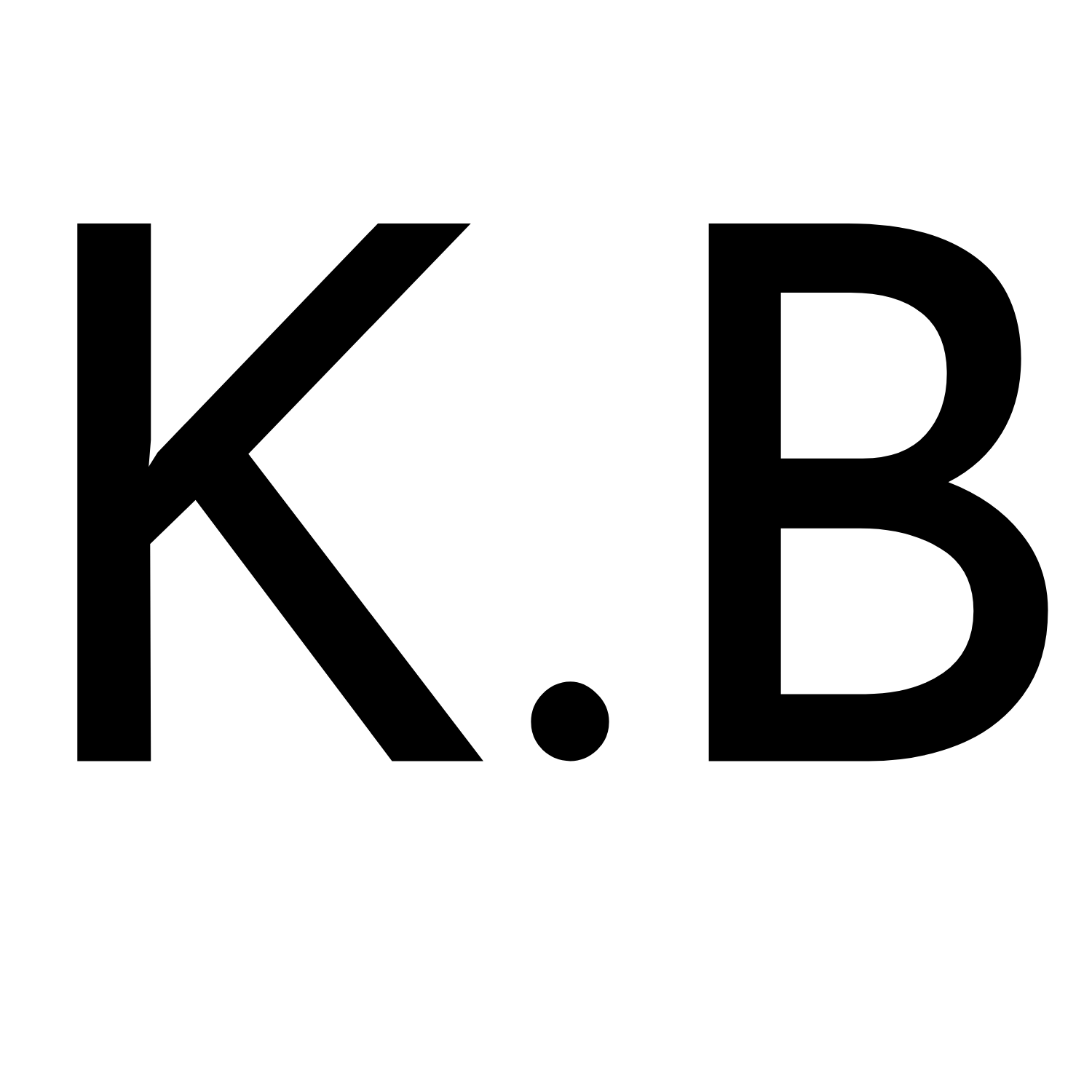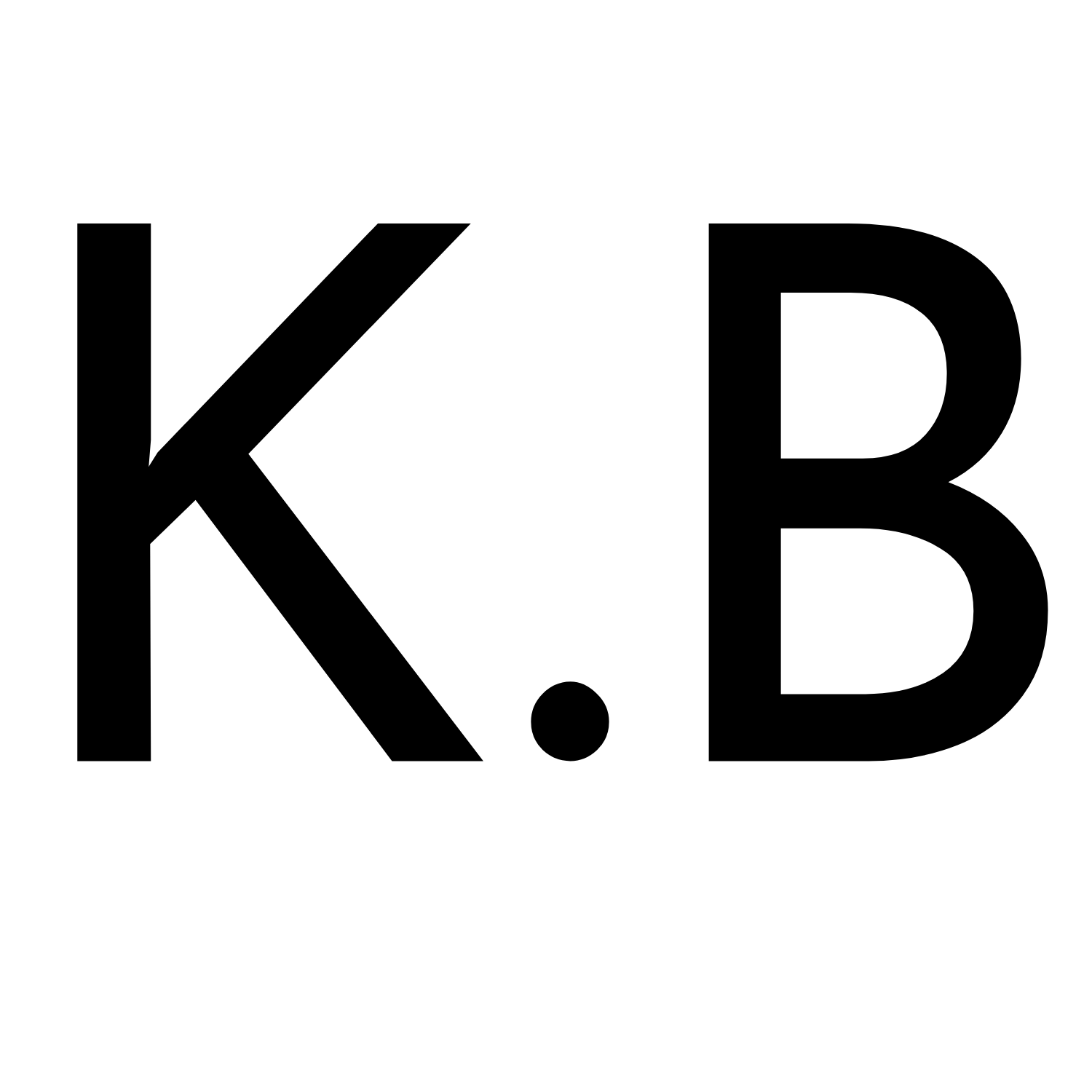Begegnung mit der Verletzlichkeit
„Es ist nicht der Kritiker, der zählt, nicht derjenige, der aufzeigt, wie der Starke gestolpert ist oder wo der, der Taten gesetzt hat, sie hätte besser machen können. Die Anerkennung gehört dem, der wirklich in der Arena ist; dessen Gesicht verschmiert ist von Staub und Schweiß und Blut; der sich tapfer bemüht; der irrt und wieder und wieder scheitert; der die große Begeisterung kennt, die große Hingabe, und sich an einer würdigen Sache verausgabt; der, im besten Fall, am Ende den Triumph der großen Leistung erfährt; und der, im schlechtesten Fall des Scheiterns, zumindest dabei scheitert, dass er etwas Großes gewagt hat…“
-Theodore Roosevelt
Ich liebe Gespräche, die mich zum Nachdenken anregen, zum Nachforschen inspirieren, zum Fragenstellen und zum Stillwerden. Zuletzt ist mir das passiert bei meinem Interview mit Heidi Kay Begay für ihren „Flute 360 - Podcast“ (nachzuhören auf Spotify und apple Podcast). Ohne eine bewusste Lenkung von uns beiden und ohne Absicht wurde daraus ein sehr offenes Gespräch über ein Thema, welches, wie ich erst danach bemerkte, mich schon lange als Musikerin und Mensch beschäftigt: Verletzlichkeit.
Auf den ersten Blick ist das kein Wort, worüber man gerne nachdenken oder gar sprechen möchte. Manch einer denkt jetzt vielleicht ich möchte hier mein Innerstes nach außen kehren, eine Methode, mit der so manche nach Aufmerksamkeit haschen und Reaktionen provozieren wollen. Das ist nicht der Hintergrund, warum ich heute hier sitze und ein paar Zeilen dazu verliere.
Indem ich aber genau das tue, in dem vollen Bewusstsein, dass, was ich hier schreibe einer Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, die mit Ablehnung, Desinteresse oder gar Abwertung auf mein Geschriebenes reagieren könnte, indem ich diese Möglichkeiten nicht nur in Kauf nehme, sondern vielleicht sogar einlade, mache ich mich verletzlich.
Seine Gedanken zu teilen, heißt sich verletzlich zu machen. Etwas zu präsentieren, was aus uns heraus entstanden ist, sei es ein Gemälde, ein Lied, oder den Klang, den wir produzieren anderen Menschen zur Beurteilung freizugeben ist ein Akt der bewussten Risikobereitschaft. Wir begeben uns, wie Roosevelt es formuliert, in die Arena und beweisen damit Mut.
Nach meinem Gespräch mit Heidi fiel mir sehr schnell ein, dass der Begriff der Verletzlichkeit bei einer meiner Lieblingsautorinnen eine zentrale Rolle einnimmt, und so bin ich tatsächlich auf ein Buch von ihr gestoßen, welches ich hier ohne Bedenken empfehlen kann: Brené Brown, „Daring greatly“ (dt. Ausgabe: „Verletzlichkeit macht stark“). Sie definiert darin den Begriff als „Ungewissheit, Risikobereitschaft und emotionale Exposition“, alles Dinge, die wir als ausführende Musiker zu unseren engsten Verbündeten oder auch zu unseren größten Feinden zählen können, je nachdem was wir daraus machen.
Eines ist sehr klar: die Arena, in der wir klassischen Musiker uns befinden und viele der leitenden Figuren darin haben seit jeher den Begriff der Verletzlichkeit als Schwäche identifiziert. Fehlbarkeit, offene Emotionalität und das Zeigen von Unsicherheiten sind lediglich den HeldInnen und AntiheldInnen unserer großen Opernbühnen erlaubt, sicher aber nicht den glänzenden Stars, die ihnen ihr Gesicht geben. Aus irgendeinem Grund stellen wir die These auf, dass, wer einmal „ganz oben“ in der Rangliste der großen Stars aufgenommen wurde durch die große Anerkennung, die er oder sie dadurch erfahren eine Art goldenes Schutzschild tragen, das sie vor dem Bewusstsein ihrer eigenen Verletzlichkeit schützt und sie immun macht gegen Ängste. Dazu kann ich nur die Geschichte einer Bekannten erzählen, die früher viel auf den großen Bühnen in Wien als Sängerin aufgetreten ist. Bei einer Produktion deren Teil sie war stand sie Seite an Seite mit dem großen Plácido Domingo. Am Tag der Premiere, kurz bevor der Vorhang aufging, beobachtete sie, wie der Star nervös auf und ab ging und kreidebleich hinter der Bühne auf seinen ersten Einsatz wartete. Es war ein Bild, das sie so gar nicht erwartet hatte von ihrem großen Idol. Sie fasste sich ein Herz nach der Vorstellung und sprach den Sänger darauf an, warum er denn bei all dem Erfolg, den er in seinem Leben hatte und hat und bei all der Liebe, die ihm vom Publikum entgegen gebracht wurde, immer noch so viel Angst vor dem Auftritt verspürte. „Sie sind doch der berühmte Plácido Domingo!“, meinte sie mit einem breiten, aufmunternden Lächeln. Die Antwort war prompt: „Ja, und ich muss jeden Abend wieder beweisen, dass ich es immer noch bin!“
Für mich ist dieser Satz nicht nur ein Zeichen dafür, dass es so etwas wie einen „perfekten Endzustand“ auf der Bühne niemals geben wird, auch nicht nach einem noch so erfolgreichen Künstlerleben. Er beweist auch, dass jeder neue Gang in die Arena - und sei uns diese noch so vertraut - uns wieder und wieder angreifbar und verwundbar macht, wenn das, was wir dort tun uns wirklich etwas bedeutet. Würden Sie also aufgrund dieser entlarvenden Aussage einen der größten Sänger unserer Zeit als „schwach“ betiteln? Würden Sie ihm sagen, dass der Beruf wohl nichts für ihn ist, wenn er so ein „schwaches“ Gemüt hat und immer noch Angst empfindet, wenn er vor sein Publikum tritt? Wohl eher nicht, seine Erfolge sprechen dafür, dass er trotz oder gerade wegen dieser Verletzlichkeit in der Lage war, eine großartige Karriere aufzubauen.
Dennoch ergeht es gerade jungen, angehenden Musikern oft genauso, wenn sie es wagen zum ersten Mal in die Arena zu schreiten. Ich erinnere mich nur allzu gut an meine eigene Probezeit im Orchester. Meine große Devise war es „bloß keine Schwäche zu zeigen“. Das sagt einem zwar keiner der Kollegen direkt ins Gesicht, ist aber in einem Betrieb, in dem man jeden Tag und oft sogar mehrmals täglich in einer Arena vor ein paar tausend Menschen sitzt - am 1.1. vor einigen Millionen - ein unausgesprochenes Gesetz. Meine Strategie war also möglichst perfekt zu sein, jeden Tag, zu jeder Uhrzeit, unter allen Umständen. Egal ob ich krank war, im Jetlag, 45 Dienste pro Monat zu stemmen hatte, es spielte einfach keine Rolle. Was das hauptsächlich zur Folge hatte war, dass ich ausgesprochen hart zu mir selbst wurde und die Verbundenheit zu meiner Umgebung und die Verbindung zu meinem Urantrieb, Musik zu machen, verloren habe. So wurde für mich ein Jahr, das für jeden Neuling in diesem Orchester schwer zu bewältigen ist aufgrund der schieren Menge des zu lernenden Opern- und symphonischen Repertoires zu einem Jahr, das mich beinahe gänzlich um meine Liebe zur Musik gebracht hätte. Heute weiß ich, ich wollte meine Verletzlichkeit opfern, um eine illusorische „Perfektion“ zu erlangen, die mich unangreifbar machen würde. Rückblickend weiß ich auch, dass genau dieses Verhalten mich sehr geschwächt hat. Schwäche heißt für mich heute, nicht bereit zu sein seine Verletzlichkeit anzunehmen.
Das mag jetzt für einige nach einer sehr pathetischen Definition klingen, ist aber im Grunde eine sehr logische Schlussfolgerung. Die Idee der Perfektion ist nur einer der Panzer, mit denen wir versuchen, uns gegen unsere eigene Verwundbarkeit zu schützen. Dieses Schutzschild führt aber nicht nur dazu uns vor den äußeren und inneren Kritikern zu schützen, sondern auch vor echten Verbindungen zu unserem Umfeld und den Menschen darin.
Ohne Verbindung keine Musik. Die Musik als unmittelbare Gegenwartskunst lebt davon, dass Menschen sich öffnen, um in Verbindung zu treten, sich berühren und mitnehmen lassen, sei es in eine Stimmung, ein inneres Bild oder eine Erzählung. Wir eröffnen als Musiker auf der Bühne einen Raum für unser Publikum, in dem es dann für den Zeitraum des Stückes leben darf. Diesen Raum können wir füllen, womit wir wollen. Wir können ihn füllen mit schönen Tönen, die bewundernswert, makellos und korrekt aneinandergereiht sind. Daran ist auch nichts Verkehrtes; das Gefühl des Publikums wird ein ähnliches sein wie in einem beeindruckenden Museum, in dem die Gegenstände platziert und von außen schön anzusehen sind. Oder aber wir eröffnen einen Raum, in dem wir in Verbindung gehen, unser Publikum direkt ansprechen, ihm etwas „erzählen“ oder es einhüllen wollen in ein Momenterlebnis, das sie wirklich berührt und mitnimmt. Die Entscheidung liegt bei uns und wird vielleicht nicht jeden Tag gleich ausfallen.
Ist Verletzlichkeit also eine Schwäche? Meine Antwort lautet nein. Wenn wir darauf warten würden, bis wir uns unverletzlich, perfekt vorbereitet oder zu 100% sicher fühlen, bevor wir uns in eine neue Arena begeben, sei es privat, beruflich oder künstlerisch, dann würden wir unser Leben wohl auf dem Flur dorthin verbringen und Erlebnisse, Beziehungen und Gelegenheiten würden verstreichen, ohne dass wir sie erfahren durften.
Deshalb wünsche ich mir für unsere Arena der klassischen Musik wieder mehr Mut zum Risiko, mehr Verbindung und Geschichtenerzähler, mehr offene Visiere, mehr Berührungspunkte und Neugier. Das ist es auch, wozu wir unsere TeilnehmerInnen der Penthesilea academy ermutigen wollen, um in Zukunft GeschichtenerzählerInnen in den Orchestern dieser Welt anzutreffen, die sich niemals und unter keinen Umständen die Liebe zu ihrer Ausdrucksform, der Musik nehmen lassen, sondern Verbindungen schaffen miteinander.
„Der Planet braucht keine erfolgreichen Menschen mehr. Der Planet braucht dringend Friedensstifter, Heiler, Erneuerer, Geschichtenerzähler und Liebende jeder Art.“ - Dalai Lama
Im Sinne eines offenen Austauschs freue ich mich über Kommentare, Gedanken, Ent-Rüstung oder Zustimmung… der Raum ist eröffnet :)
Hier gehts nochmal zum Interview mit Heidi Kay Begay.